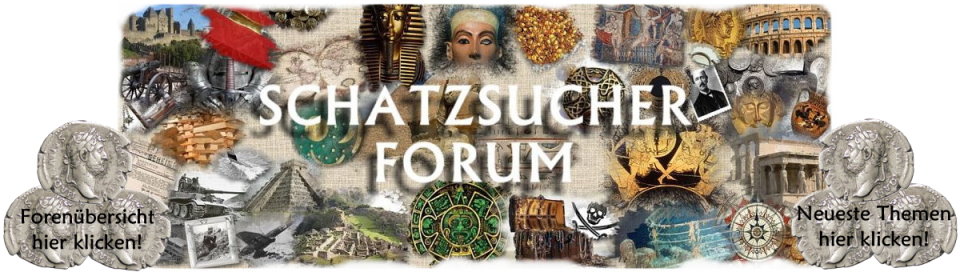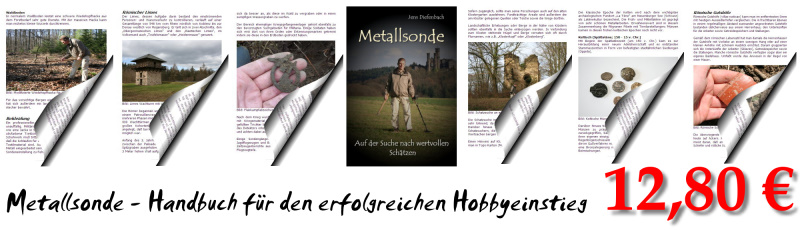Die Beschaffenheit des Bodens hat großen Einfluss auf die Eindringtiefe, die Erkennung der Metallart (Leitwerte).
Oft wird der Bodenmineralisation in der Suche die geringste Bedeutung beigemessen…
Was ist ein mineralisierter Boden?
Unter Mineralisierung versteht man die Freisetzung von organisch gebundenen, chemischen Elemente und deren anschließende Umwandlung in anorganische Verbindungen im Boden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Boden_%28Bodenkunde%29
Störungen
Für eine Detektorsuche muss beachtet werden wie hoch der Anteil von magnetischen und anderen leitenden Substanzen im Boden ist. Ebenso können durch organische Stoffe wie bspw. Steinkohle und deren Verarbeitungsprodukte (Koks) zu Störungen führen.
Meiner Meinung nach geht hierbei der gößte Einfluss vom Eisenoxid (Fe3o4) aus.
Die Mineralisierung werden generell in drei Gruppen eingeteilt:
geringe bis leichte Mineralisierung
Diese treten in erster Linie bei hellen Sandböden, schwerpunktmäßig bei Quarzsand, auf. Weiterhin kann man bei Löß- und Tuffböden (Tuff ist zwar ein vulkanisches Material, weist aber auf Grund seiner lockeren Beschaffenheit eine geringe Dichte auf) auch von einer geringeren Mineralisation ausgehen.
mittelere Mineralisierung
Ca. 80% der Deutschen Böden weisen eine mittlere Mineralisierung auf. Diese Böden sind dann oftmals im feuchten Zustand dunkelbraun bis rotbraun.
Es kann aber auch in diesen Böden zu höheren Mineralisierungen kommen.
hohe Mineralisierung
Diese kann kann bei allen roten Böden angenommen werden. Ebenso sind Erzabbauregionen normalerweise sehr stark mineralisiert. Dazu kommen dann noch Haldenflächen und ehemalige Produktionsbereich in denen Schlacken entsorgt oder zwischengelagert wurden.
Alle vulkanisch tätigen Regionen weisen ebenfalls eine sehr hohe Mineralisierung der Böden auf.
In Teilen der Eifelregion bis hin nach Luxemburg, Vogelbergkreis, dem Harz, in Teilen der Pfalz, dem Saarland,... treffen wir immer wieder auf solche Flächen.
Auf Grund des Mangels an tiefgreifenden Fachkenntnissen ist es für viele Sondengänger schwierig den Grad der Mineralisierung einer abzusuchenden Fläche eindeutig zu bestimmen.
Es gibt jedoch einige Abhilfen um zumindest eine ungefähre Bestimmung vorzunehmen:
Magnet:
Führt man einen starken Magneten über und durch den trockenen Boden, werden magnetische Bestandteile angezogen. Je höher dieser Anteil ist, um so stärker ist der Boden dann auch als mineralisiert ein zu stufen. Dies ist um so besser einzuordnen je stärker der Magnet ist.
Landschafts- Luftbildaufnahmen:
Hierbei erkennt man, zumindest ungefähr die farbliche Struktur der bisher noch nicht prospektierten Suchgebiete und kann sich an Hand der Einordnung oben einen ungefähren Überblick verschaffen.
Bauernverband:
Die regionalen Bauerverbände halten sog. Bodenrichtwerttabellen vor. In diesen ist die Mineralisierung der Böden auch gut zu erkennen.
Einfluss:
Die Mineralisierung beeinflsst die Trennschäfe der Signale und auch die Tiefenleistung des Detektors.
Je höher die Mineralisierung ist, um so geringer ist die Eindringtiefe und Anzeigengenauigkeit.
Der Einfluss einer hohen Bodenmineralisierung auf Geräte mit einem fix vorgegebenen Bodenwert ist in der Regel höher, da hier keine manuellen Anpassungen der Einstellungen vorgenommen werden können.
Also verliert ein werksseitig voreingestellter Detektor in stark mineralisierten Bereichen an Laufruhe.
Die Voreinstellung bringt es dann aber leider auch mit sich, das auf schwächer mineralisierten Böden die Leistung des Gerätes nicht voll ausgeschöpft werden kann.
Ich denke es ist bei regelbaren Detektoren nicht nur zu Beginn der Suche eine optimale Bodenanpassung durch zu führen sondern auch bei einem wechsel der Bodenbedingungen.
Wie oft und wann gleicht IHR bei der Suche ab?
Links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Boden_%28Bodenkunde%29